... newer stories
Dienstag, 5. Mai 2009
Panikmache mit FSME
malamud, 13:45h
In diesem sehenswerten Beitrag der SWR Sendung Report geht es um Geschäftemacherei mit der FSME-Impfung in Deutschland und um verschwiegene Nebenwirkungen.


... link (1 Kommentar) ... comment
Der war's!
malamud, 13:21h

... link (0 Kommentare) ... comment
Pandemic = Epidemie + Panic
malamud, 04:54h
Angesichts der bevorstehenden Ausrufung der höchsten Pandemie-Warnstufe durch die WHO erinnern sich auch in den USA immer mehr Mediziner und Politiker daran, dass die Schweinegrippe schon mal ein Thema war (siehe "Das Schweinegrippe-Debakel").
Der Kongress-Abgeordnete Ron Paul war damals einer von nur zwei Politikern, die gegen die staatlichen Maßnahmen - einer generellen Durchimpfung der Bevölkerung gegen die Schweinegrippe votierten.
Hier zum Ausgleich ein Beispiel für die Art von Information die von der US-Behörde CDC generell (abseits der Schweinegrippe) zum Thema Influenza geliefert wird.
Ein propagandistisches Plädoyer für die Impfung, das unter die Haut geht und als Konsequenz der Verweigerung den Tod der eigenen Kinder androht.
Natürlich ohne jegliche Hinweise über mögliche Nebenwirkungen der Impfung - oder über den laut Cochrane-Metaanalyse fehlenden Nachweis einer Wirkung der Grippe-Impfung im Alter zwischen sechs Monaten und zwei Jahren.
Zitat:
In children under the age of two, the efficacy of inactivated vaccine was similar to placebo.
In dieser britischen Studie wurde die Wirksamkeit der Influenza-Impfung bei Kindern zwischen 6 und 59 Monaten im Verlauf von zwei Influenza-Saisonen (2003/04 + 2004/05) getestet.
Zitat:
Significant influenza VE (vaccine effectiveness) could not be demonstrated for any season, age, or setting after adjusting for county, sex, insurance, chronic conditions recommended for influenza vaccination, and timing of influenza vaccination (VE estimates ranged from 7%-52% across settings and seasons for fully vaccinated 6- to 59-month-olds).
Von all diesen Fakten ist im Propaganda-Machwerk der CDC keine Rede. Hier wird stattdessen in übelster Manier - und als Hohn auf die Forderung nach "informierter Entscheidungsfindung" bei medizinischen Interventionen – Stimmung gemacht.
Und das von jener Behörde, die nun, im Verbund mit der WHO, auch bei der Influenza A/H1N1 (vormals Schweinegrippe) die weltweite Vorgehensweise bestimmt:
Der Kongress-Abgeordnete Ron Paul war damals einer von nur zwei Politikern, die gegen die staatlichen Maßnahmen - einer generellen Durchimpfung der Bevölkerung gegen die Schweinegrippe votierten.
Hier zum Ausgleich ein Beispiel für die Art von Information die von der US-Behörde CDC generell (abseits der Schweinegrippe) zum Thema Influenza geliefert wird.
Ein propagandistisches Plädoyer für die Impfung, das unter die Haut geht und als Konsequenz der Verweigerung den Tod der eigenen Kinder androht.
Natürlich ohne jegliche Hinweise über mögliche Nebenwirkungen der Impfung - oder über den laut Cochrane-Metaanalyse fehlenden Nachweis einer Wirkung der Grippe-Impfung im Alter zwischen sechs Monaten und zwei Jahren.
Zitat:
In children under the age of two, the efficacy of inactivated vaccine was similar to placebo.
In dieser britischen Studie wurde die Wirksamkeit der Influenza-Impfung bei Kindern zwischen 6 und 59 Monaten im Verlauf von zwei Influenza-Saisonen (2003/04 + 2004/05) getestet.
Zitat:
Significant influenza VE (vaccine effectiveness) could not be demonstrated for any season, age, or setting after adjusting for county, sex, insurance, chronic conditions recommended for influenza vaccination, and timing of influenza vaccination (VE estimates ranged from 7%-52% across settings and seasons for fully vaccinated 6- to 59-month-olds).
Von all diesen Fakten ist im Propaganda-Machwerk der CDC keine Rede. Hier wird stattdessen in übelster Manier - und als Hohn auf die Forderung nach "informierter Entscheidungsfindung" bei medizinischen Interventionen – Stimmung gemacht.
Und das von jener Behörde, die nun, im Verbund mit der WHO, auch bei der Influenza A/H1N1 (vormals Schweinegrippe) die weltweite Vorgehensweise bestimmt:
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 2. Mai 2009
Die Gripperl-Pandemie
malamud, 18:25h
Es gibt derzeit wohl weltweit kein News-Portal, in dem die Influenza-Pandemie nicht Titelthema ist. Und das seit Wochen. Wir werden damit in einem Ausmaß belästigt, das der realen mit der Krankheit verbundenen Bedrohung diametral entgegen steht. Deshalb geben wir hier im blog zum Ausgleich Entwarnung und versuchen die Gründe zu verstehen, warum ein Großteil der weltweiten Influenza-Community im Verbund mit den Medien derzeit durchdreht.

Jetzt bestellen: Das Schweinegrippe Pandemie-Set um nur 26,17 €
Die WHO überlegt angestrengt, ob die höchste Pandemie-Warnstufe 6 ausgerufen werden soll, beim Meeting der EU-Gesundheitsminister war die Grippe das beherrschende Thema und in Mexico-City wurde ein "War-Room" eingerichtet, in dem die Experten rund um die Uhr tagen und die positiven Virentests auf ihren Pandemie-Landkarten eintragen. Für diese Woche wird nun die Entscheidung erwartet, ob die groß angelegte Produktion eines eigenen Impfstoffes gegen A/H1N1 angeordnet wird. Man hat den Eindruck als stünden wir am Rande des Abgrunds. Und das angesichts einer Bedrohung, die in etwa die Zerstörungskraft eines Frühlingsschnupfens hat.
Besonders schlimm ist die Lage in Deutschland, wo laut Jörg Hacker, dem Präsidenten des Robert-Koch-Institutes nun eine "neue Situation eingetreten ist": Eine Krankenschwester hat sich bei einem Grippe-Patienten angesteckt. Zwar sind beide längst wieder wohlauf, doch Angela Merkel gab bekannt, dass fortan die Bundesregierung "bis auf weiteres jeden Mittwoch" über die Pandemie beraten werde.
Welche neue Pest treibt hier ihr Unwesen?
Zunächst waren in einem hysterischen Wettlauf die aus Mexico gemeldeten Todesfälle hochgeschnellt - und hielten bald bei deutlich über 100 Opfern. Hier wurde scheinbar jeder Phantast zitiert, der die Courage hatte, vor die Kameras zu treten. Tatsächlich war bei den Patienten aber gar nicht untersucht worden, ob sie überhaupt an der Influenza litten. Nun gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die Zahl der bestätigten Influenza Todesfälle bei 15 liegt.
Wir beobachten staunend das Krisen-Management eines Influenza-Apparates, der mit Milliardenaufwand aus Steuergeldern finanziert wird und derzeit alles Erdenkliche unternimmt, seine eigene Existenz zu rechtfertigen.
In fast allen Äußerungen dieser Experten klingt die kaum verhohlene Freude mit, dass es nun endlich eine Chance gibt, sich in Szene zu setzen. Und mit Stolz verweisen die Experten auf ihre eigene Rolle bei der Einrichtung von nationalen Pandemie-Plänen, sowie der Bevorratung mit Influenza Medikamenten und Grippe-Schutzmasken.
Das was Kritiker als rausgeschmissenes Geld bezeichnet haben, habe sich nunmehr - dank ihrem weisen Rat - als gut investierte Gesundheitsvorsorge erwiesen.
Über viele Jahre sind wir es gewöhnt, zur Grippe-Impf-Saison regelmäßig mit Horrorzahlen versorgt zu werden, deren Wahrheitsgehalt irgendwo zwischen Hänsel und Gretel im tiefen tiefen Wald verloren gegangen ist. Erst kürzlich - beim Runden Tisch zum Thema Schweinegrippe im ORF - wiederholte die Vizepräsidentin der Apothekerkammer Christiane Körner wieder mal das bekannten Influenza-Schauermärchen: Etwa 2.000 bis 4.000 Opfer fordere demnach die ganz normale Grippe in Österreich - und das jeden Winter. Auch das Robert Koch Institut spricht, je nach Laune, von jährlich 12.000 bis 15.000 Todesopfer, die auch schon mal auf 20.000 aufgerundet werden, wie die Zeit in ihrem dramatischen Bericht "Impf oder stirb!" in Erfahrung brachte.
Irgendwie scheint es, als habe diese Zahlen aber ohnehin nie jemand geglaubt.
Wie wäre es sonst möglich, dass die 15 bestätigten Todesfälle aus Mexico nun ein Vielfaches des Raumes einnehmen, den zuvor die Finanzkrise beanspruchte.
Die derzeitige Influenza-Epidemie ist wenig ansteckend, sie verursacht kaum Beschwerden mit nur geringem Fieber und sie heilt im Normalfall rasch wieder aus.
Doch sie bietet - auf Grund des kollektiven Traumas, das die „Spanische Grippe“ vom Nachkriegswinter 1919 hinterlassen hat, noch immer den Stoff aus dem die guten Horrorgeschichten geschnitzt werden.
So wurde in den Mexikanischen Medien viel über die Gemeinde La Gloria berichtet, wo von 2.155 Bewohnern 616 an der Influenza erkrankt seien. Diese Gemeinde, erklärten Experten, sei ein Zentrum der Schweineindustrie, die Zucht- und Mastställe lägen unmittelbar im Wohngebiet und mit hoher Wahrscheinlichkeit sei La Gloria der Ground Zero der Schweinegrippe: hier ist das Virus vom Schwein auf die Menschen übergesprungen.
Doch so wie die Horror-Todeszahlen erwies sich auch diese Nachricht bei näherer Untersuchung als bloße Mär. Der Direktor des Nationalen Zentrums für Epidemiologie in Mexico, Miguel Angel Lezana, erklärte nach einem Lokal-Augenschein Reportern der Washington Post, dass es wenig Belege dafür gibt, dass La Gloria tatsächlich die Brutstätte des aktuellen Virus ist: „Die Schweineställe sind weit von der Wohnsiedlung entfernt. Untersuchungen der Schweine ergaben keinerlei Hinweise auf Influenza.“ Zudem seien unter den hunderten „Influenza-Opfern“ von La Gloria in Wahrheit nur bei einem einzigen auch tatsächlich die Grippeviren gefunden worden: Bei einem fünfjährigen Buben, der längst wieder gesund ist.
Auf den Internet-Seiten der US-Gesundheitsbehörde CDC wird den Ärzten geraten, bei Verdachtsfällen sofort Relenza oder Tamiflu zu verschreiben. Den Patienten wird sogar die vorbeugende Einnahme der umstrittenen und Nebenwirkungs-reichen Medikamente empfohlen, falls sie in Kontakt mit Verdachtsfällen kämen.
Beim derzeit herrschenden Irrsinn ist es wohl zu erwarten, dass in der nächsten Woche - gegen alle Vernunft - die höchste Pandemie-Warnstufe ausgerufen wird, die auch den Startschuss zur Herstellung eines eigenen Pandemie-Impfstoffes bedeutet.
Nachdem schon bisher die Produktion von Vogelgrippe-Impfstoff von einigen Pannen und Katastrophen begleitet war, werden wir wohl auch in den nächsten Monaten noch einige Highlights des modernen Katastrophen-Managements mit verfolgen.
Relativ risikolos lässt sich jetzt schon prophezeien, dass die Bekämpfung der Pandemie jedenfalls deutlich mehr Opfer fordern wird, als die Pandemie selbst.

Jetzt bestellen: Das Schweinegrippe Pandemie-Set um nur 26,17 €
Die WHO überlegt angestrengt, ob die höchste Pandemie-Warnstufe 6 ausgerufen werden soll, beim Meeting der EU-Gesundheitsminister war die Grippe das beherrschende Thema und in Mexico-City wurde ein "War-Room" eingerichtet, in dem die Experten rund um die Uhr tagen und die positiven Virentests auf ihren Pandemie-Landkarten eintragen. Für diese Woche wird nun die Entscheidung erwartet, ob die groß angelegte Produktion eines eigenen Impfstoffes gegen A/H1N1 angeordnet wird. Man hat den Eindruck als stünden wir am Rande des Abgrunds. Und das angesichts einer Bedrohung, die in etwa die Zerstörungskraft eines Frühlingsschnupfens hat.
Besonders schlimm ist die Lage in Deutschland, wo laut Jörg Hacker, dem Präsidenten des Robert-Koch-Institutes nun eine "neue Situation eingetreten ist": Eine Krankenschwester hat sich bei einem Grippe-Patienten angesteckt. Zwar sind beide längst wieder wohlauf, doch Angela Merkel gab bekannt, dass fortan die Bundesregierung "bis auf weiteres jeden Mittwoch" über die Pandemie beraten werde.
Welche neue Pest treibt hier ihr Unwesen?
Zunächst waren in einem hysterischen Wettlauf die aus Mexico gemeldeten Todesfälle hochgeschnellt - und hielten bald bei deutlich über 100 Opfern. Hier wurde scheinbar jeder Phantast zitiert, der die Courage hatte, vor die Kameras zu treten. Tatsächlich war bei den Patienten aber gar nicht untersucht worden, ob sie überhaupt an der Influenza litten. Nun gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die Zahl der bestätigten Influenza Todesfälle bei 15 liegt.
Wir beobachten staunend das Krisen-Management eines Influenza-Apparates, der mit Milliardenaufwand aus Steuergeldern finanziert wird und derzeit alles Erdenkliche unternimmt, seine eigene Existenz zu rechtfertigen.
In fast allen Äußerungen dieser Experten klingt die kaum verhohlene Freude mit, dass es nun endlich eine Chance gibt, sich in Szene zu setzen. Und mit Stolz verweisen die Experten auf ihre eigene Rolle bei der Einrichtung von nationalen Pandemie-Plänen, sowie der Bevorratung mit Influenza Medikamenten und Grippe-Schutzmasken.
Das was Kritiker als rausgeschmissenes Geld bezeichnet haben, habe sich nunmehr - dank ihrem weisen Rat - als gut investierte Gesundheitsvorsorge erwiesen.
Über viele Jahre sind wir es gewöhnt, zur Grippe-Impf-Saison regelmäßig mit Horrorzahlen versorgt zu werden, deren Wahrheitsgehalt irgendwo zwischen Hänsel und Gretel im tiefen tiefen Wald verloren gegangen ist. Erst kürzlich - beim Runden Tisch zum Thema Schweinegrippe im ORF - wiederholte die Vizepräsidentin der Apothekerkammer Christiane Körner wieder mal das bekannten Influenza-Schauermärchen: Etwa 2.000 bis 4.000 Opfer fordere demnach die ganz normale Grippe in Österreich - und das jeden Winter. Auch das Robert Koch Institut spricht, je nach Laune, von jährlich 12.000 bis 15.000 Todesopfer, die auch schon mal auf 20.000 aufgerundet werden, wie die Zeit in ihrem dramatischen Bericht "Impf oder stirb!" in Erfahrung brachte.
Irgendwie scheint es, als habe diese Zahlen aber ohnehin nie jemand geglaubt.
Wie wäre es sonst möglich, dass die 15 bestätigten Todesfälle aus Mexico nun ein Vielfaches des Raumes einnehmen, den zuvor die Finanzkrise beanspruchte.
Die derzeitige Influenza-Epidemie ist wenig ansteckend, sie verursacht kaum Beschwerden mit nur geringem Fieber und sie heilt im Normalfall rasch wieder aus.
Doch sie bietet - auf Grund des kollektiven Traumas, das die „Spanische Grippe“ vom Nachkriegswinter 1919 hinterlassen hat, noch immer den Stoff aus dem die guten Horrorgeschichten geschnitzt werden.
So wurde in den Mexikanischen Medien viel über die Gemeinde La Gloria berichtet, wo von 2.155 Bewohnern 616 an der Influenza erkrankt seien. Diese Gemeinde, erklärten Experten, sei ein Zentrum der Schweineindustrie, die Zucht- und Mastställe lägen unmittelbar im Wohngebiet und mit hoher Wahrscheinlichkeit sei La Gloria der Ground Zero der Schweinegrippe: hier ist das Virus vom Schwein auf die Menschen übergesprungen.
Doch so wie die Horror-Todeszahlen erwies sich auch diese Nachricht bei näherer Untersuchung als bloße Mär. Der Direktor des Nationalen Zentrums für Epidemiologie in Mexico, Miguel Angel Lezana, erklärte nach einem Lokal-Augenschein Reportern der Washington Post, dass es wenig Belege dafür gibt, dass La Gloria tatsächlich die Brutstätte des aktuellen Virus ist: „Die Schweineställe sind weit von der Wohnsiedlung entfernt. Untersuchungen der Schweine ergaben keinerlei Hinweise auf Influenza.“ Zudem seien unter den hunderten „Influenza-Opfern“ von La Gloria in Wahrheit nur bei einem einzigen auch tatsächlich die Grippeviren gefunden worden: Bei einem fünfjährigen Buben, der längst wieder gesund ist.
Auf den Internet-Seiten der US-Gesundheitsbehörde CDC wird den Ärzten geraten, bei Verdachtsfällen sofort Relenza oder Tamiflu zu verschreiben. Den Patienten wird sogar die vorbeugende Einnahme der umstrittenen und Nebenwirkungs-reichen Medikamente empfohlen, falls sie in Kontakt mit Verdachtsfällen kämen.
Beim derzeit herrschenden Irrsinn ist es wohl zu erwarten, dass in der nächsten Woche - gegen alle Vernunft - die höchste Pandemie-Warnstufe ausgerufen wird, die auch den Startschuss zur Herstellung eines eigenen Pandemie-Impfstoffes bedeutet.
Nachdem schon bisher die Produktion von Vogelgrippe-Impfstoff von einigen Pannen und Katastrophen begleitet war, werden wir wohl auch in den nächsten Monaten noch einige Highlights des modernen Katastrophen-Managements mit verfolgen.
Relativ risikolos lässt sich jetzt schon prophezeien, dass die Bekämpfung der Pandemie jedenfalls deutlich mehr Opfer fordern wird, als die Pandemie selbst.
... link (1 Kommentar) ... comment
Montag, 27. April 2009
Beruhigungsmittel Tamiflu
malamud, 19:01h
"Angst vor dem viralen Supergau", betitelt Focus online eine bange Story über die kommende Influenza-Pandemie. "Schweinegrippe-Virus springt auf USA über", lieferte Spiegel online erste Belege. Und Michael Kunze, Österreichs oberster Sozialmediziner sah sich in Interviews ob seiner Einschätzung der Gefährlichkeit von Influenza vollständig bestätigt. Hält er es doch nun für möglich, dass sich seine 2005 - anlässlich der Vogelgrippe-Hysterie - geäußerte Prognose, "in spätestens fünf Jahren kommt die weltweite Pandemie mit Millionen Todesopfern", doch noch als seriöse Warnung erweist.

Kalifornische Nonnen haben ihre Virenschutzmasken aus der Seuchenvorratskammer geholt
Je nach Quelle sind in Mexico bereits "über 60 " (Spiegel) oder "mindestens 103" (Dow-Jones-Newswire) Menschen an der verdächtigen Virusvariante, gestorben. Mexicos Gesundheitsminister Jose Angel Cordova gab im Fernsehen bekannt, dass sich derzeit rund 500 Personen mit Verdacht auf Schweinegrippe in Krankenhäusern befinden.
Doch die Rettung naht: Der Basler Roche-Konzern kündigte heute an, dass umgehend die Produktion der berühmten Influenza-Pille Tamiflu wieder hoch gefahren wird. Und weil dieser Prozess bis zum Endprodukt acht Monate in Anspruch nimmt, zeige sich nun, so eine Firmensprecherin, dass jene Behörden und Institutionen, die rechtzeitig vorgesorgt haben, eben doch die Klügeren waren.
Wie ernst sind nun all diese Meldungen zu nehmen?
Steht wirklich eine tödliche Pandemie bevor - oder wird nach der Vogelgrippe nun die nächste Viren-Sau durchs Weltdorf getrieben, auf dass zumindest die Pharmaindustrie von der Finanzkrise verschont bleibe?
Zunächst fällt es schwer, bei den aus Mexico gemeldeten Todesfällen den sicheren Bezug zur Influenza herzustellen, wenn - laut WHO derzeit in Mexico gerade mal 18 Labor-bestätigte Krankheitsfälle vorliegen. Und das, obwohl die Grippewelle, angeblich bereits im März ihren Ausgang nahm.
In den USA halten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) derzeit bei 20 bestätigten Fällen. Sie seien alle mild verlaufen, erklärte ein Behördensprecher, nur in einem Fall sei eine kurzfristige Hospitalisierung notwendig gewesen.
Sollten die Viren über der Grenze zu Mexico wesentlich schlimmere Infektionen auslösen? Das wäre eigenartig.
Einig sind sich die meisten Experten in der Empfehlung, sicherheitshalber eine Packung Tamiflu bereit zu halten.
Die CDC erklärte, dass Tamiflu (ebenso wie das zweite Mittel, Relenza) gegen die Schweingrippen-Variante des Influenza-A Typs H1N1 wirksam sei.
Doch was heißt das?
Aus klinischen Studien weiß man, dass Tamiflu die Symptome der Influenza abschwächt, den Krankheitsverlauf ein wenig verkürzt, ebenso die Zusatzkomplikationen.
Dies aber auch nur, wenn die Medikamente binnen 48 Stunden nach dem Einsetzen der ersten Symptome genommen werden.
Wie sich das zeitlich mit dem Rat der CDC vertragen soll, Medikamente nur nach definitiver Bestimmung durch
a) entweder real-time PCR oder
b) Virenkultur
einzunehmen, bleibt ein Rätsel, wenn nur die wenigsten Krankenhäuser in der Lage sind, diese Nachweise - noch dazu binnen kürzester Zeit zu erbringen.
Im realen Leben wird wohl jede Person, die über Tamiflu verfügt, das Mittel beim kleinsten Kribbeln im Hals sicherheitshalber einwerfen.
Ob das auch der Sicherheit dient, ist weniger sicher. Bislang konnte noch in keiner Studie gezeigt werden, dass Tamiflu die Sterblichkeit senkt. Auch bei Vogelgrippe-Patienten versagte Tamiflu. Hier wurde stets betont, dass die Medikamente zu spät eingenommen worden waren.
In Japan, dem Land mit der längsten Tradition in der Anwendung dieser Medikamente, gilt seit 2007 ein Tamiflu-Verbot für Teenager, nachdem es hier zu einer Reihe von mysteriösen Selbstmorden gekommen war. Auch in den USA wurden bei Kindern Halluzinationen, Verwirrtheit und Krampfanfälle berichtet.
Häufigste in den Zulassungsstudien beobachtete "normale" Nebenwirkungen waren Erbrechen (8%), Übelkeit (7,9%) und Bauchschmerzen (2,2%).
Wie es aussieht, werden die Viren auch schneller als befürchtet gegen die Mittel resistent - wie ein Artikel der New York Times zur Influenzasaison des zurückliegenden Winters zeigte:
Last winter, about 11 percent of the throat swabs from patients with the most common type of flu that were sent to the Centers for Disease Control and Prevention for genetic typing showed a Tamiflu-resistant strain. This season, 99 percent do.
“It’s quite shocking,” said Dr. Kent A. Sepkowitz, director of infection control at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. “We’ve never lost an antimicrobial this fast. It blew me away.”
Das Schweinegrippe-Debakel
Wenn derzeit jede Option etwas trostlos erscheint, so wissen wir wenigstens, wie mit solchen Phänomenen nicht umzugehen ist. Die Vorfälle ereigneten sich vor mehr als 30 Jahren in den USA und gingen als großes Schweinegrippen-Debakel in die Medizingeschichte ein.
Damals, am 4. Februar 1976 starb ein junger Soldat in einer Kaserne in New Jersey an Grippe, 19 weitere waren krank und drei davon waren von denselben Viren befallen wie das Todesopfer. In der Laboranalye zeigte sich, dass diese Unterart der Grippeviren starke Ähnlichkeit mit jenen hatte, die normalerweise nur Schweine befällt.
Diese Nachricht schlug in der wissenschaftlichen Kommune der Infektionsexperten ein wie eine Bombe: War die Grippe von den Schweinen auf die Menschen übergesprungen? Handelte es sich hier um eine mutierte Abart jener Viren, die im Nachkriegswinter 1918/19 jene weltweite Katastrophe ausgelöst hatte, in dessen Verlauf mehr Menschen starben als zuvor in vier Kriegsjahren. Die Expertengremien tagten rund um die Uhr, die Zeit drängte und schließlich wurde gehandelt. Präsident Gerald Ford verkündete im Fernsehen, dass „jeder Mann, jede Frau und jedes Kind“ in einer konzertierten Aktion gegen die tödlichen Epidemie geimpft werde. Ansonsten – so die dramatische Hochrechnung – würden noch im selben Jahr 1976 rund eine Million Amerikaner sterben.

President Gerald Ford geht mit Beispiel voran
Obwohl es in der Kaserne in New Jersey bei dem einen Todesfall blieb und weitere fünfhundert infizierte Soldaten mit der Grippe leicht fertig wurden, lief die Produktion des im Hauruck-Verfahren zugelassenen Impfstoffes das ganze Jahr über auf Hochtouren, um im Herbst, wenn das tödliche Virus zweifellos wiederkommen würde, gerüstet zu sein.
Und schließlich startete die generalstabsmäßig vorbereitete Aktion. Gleich zu Beginn starben in Pittsburgh drei Geimpfte innerhalb weniger Stunden. Das wurde als tragischer Zufall angesehen, die Aktion lief weiter. Insgesamt 45 Millionen Impfungen wurden verabreicht, zahlreiche Nebenwirkungen traten auf. Doch das galt als notwendiger Preis, den es für die Abwendung einer Katastrophe eben zu zahlen galt. Bis im Dezember 1976 ein Zwischenbericht der Behörden erschien, der zeigte, dass die Nebenwirkungen ein enormes Ausmaß annahmen. Besonders alarmierend war das Auftreten tausender Fälle von Guillain-Barre-Syndrom (GBS). Bei dieser Störung des Immunsystems leiden die Patienten unter Lähmungen, die tödlich enden können.
Am 16. Dezember wurde die Impfkampagne eingestellt. Die GBS-Opfer bekamen 90 Millionen Dollar Schadenersatz. Insgesamt hatte die Aktion 400 Millionen Dollar gekostet. Was die meisten Medizin-Experten für eine gute Idee gehalten hatten, ging stattdessen als Debakel in die Annalen der Medizin ein.
Harvey Fineberg, Dekan der Harvard School of Public Health gab in seiner abschließenden Analyse der Aktion auch einige Warnungen für die Zukunft mit: „Versprechen wir uns nicht zuviel von unseren Möglichkeiten“, appellierte er, „denken wir stets auch an das Unerwartete und rechnen wir niemals damit, dass die Experten später – wenn die Dinge sich überraschend ändern – auch noch zu dem stehen, was sie vorher gemeinsam empfohlen haben.“

Kalifornische Nonnen haben ihre Virenschutzmasken aus der Seuchenvorratskammer geholt
Je nach Quelle sind in Mexico bereits "über 60 " (Spiegel) oder "mindestens 103" (Dow-Jones-Newswire) Menschen an der verdächtigen Virusvariante, gestorben. Mexicos Gesundheitsminister Jose Angel Cordova gab im Fernsehen bekannt, dass sich derzeit rund 500 Personen mit Verdacht auf Schweinegrippe in Krankenhäusern befinden.
Doch die Rettung naht: Der Basler Roche-Konzern kündigte heute an, dass umgehend die Produktion der berühmten Influenza-Pille Tamiflu wieder hoch gefahren wird. Und weil dieser Prozess bis zum Endprodukt acht Monate in Anspruch nimmt, zeige sich nun, so eine Firmensprecherin, dass jene Behörden und Institutionen, die rechtzeitig vorgesorgt haben, eben doch die Klügeren waren.
Wie ernst sind nun all diese Meldungen zu nehmen?
Steht wirklich eine tödliche Pandemie bevor - oder wird nach der Vogelgrippe nun die nächste Viren-Sau durchs Weltdorf getrieben, auf dass zumindest die Pharmaindustrie von der Finanzkrise verschont bleibe?
Zunächst fällt es schwer, bei den aus Mexico gemeldeten Todesfällen den sicheren Bezug zur Influenza herzustellen, wenn - laut WHO derzeit in Mexico gerade mal 18 Labor-bestätigte Krankheitsfälle vorliegen. Und das, obwohl die Grippewelle, angeblich bereits im März ihren Ausgang nahm.
In den USA halten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) derzeit bei 20 bestätigten Fällen. Sie seien alle mild verlaufen, erklärte ein Behördensprecher, nur in einem Fall sei eine kurzfristige Hospitalisierung notwendig gewesen.
Sollten die Viren über der Grenze zu Mexico wesentlich schlimmere Infektionen auslösen? Das wäre eigenartig.
Einig sind sich die meisten Experten in der Empfehlung, sicherheitshalber eine Packung Tamiflu bereit zu halten.
Die CDC erklärte, dass Tamiflu (ebenso wie das zweite Mittel, Relenza) gegen die Schweingrippen-Variante des Influenza-A Typs H1N1 wirksam sei.
Doch was heißt das?
Aus klinischen Studien weiß man, dass Tamiflu die Symptome der Influenza abschwächt, den Krankheitsverlauf ein wenig verkürzt, ebenso die Zusatzkomplikationen.
Dies aber auch nur, wenn die Medikamente binnen 48 Stunden nach dem Einsetzen der ersten Symptome genommen werden.
Wie sich das zeitlich mit dem Rat der CDC vertragen soll, Medikamente nur nach definitiver Bestimmung durch
a) entweder real-time PCR oder
b) Virenkultur
einzunehmen, bleibt ein Rätsel, wenn nur die wenigsten Krankenhäuser in der Lage sind, diese Nachweise - noch dazu binnen kürzester Zeit zu erbringen.
Im realen Leben wird wohl jede Person, die über Tamiflu verfügt, das Mittel beim kleinsten Kribbeln im Hals sicherheitshalber einwerfen.
Ob das auch der Sicherheit dient, ist weniger sicher. Bislang konnte noch in keiner Studie gezeigt werden, dass Tamiflu die Sterblichkeit senkt. Auch bei Vogelgrippe-Patienten versagte Tamiflu. Hier wurde stets betont, dass die Medikamente zu spät eingenommen worden waren.
In Japan, dem Land mit der längsten Tradition in der Anwendung dieser Medikamente, gilt seit 2007 ein Tamiflu-Verbot für Teenager, nachdem es hier zu einer Reihe von mysteriösen Selbstmorden gekommen war. Auch in den USA wurden bei Kindern Halluzinationen, Verwirrtheit und Krampfanfälle berichtet.
Häufigste in den Zulassungsstudien beobachtete "normale" Nebenwirkungen waren Erbrechen (8%), Übelkeit (7,9%) und Bauchschmerzen (2,2%).
Wie es aussieht, werden die Viren auch schneller als befürchtet gegen die Mittel resistent - wie ein Artikel der New York Times zur Influenzasaison des zurückliegenden Winters zeigte:
Last winter, about 11 percent of the throat swabs from patients with the most common type of flu that were sent to the Centers for Disease Control and Prevention for genetic typing showed a Tamiflu-resistant strain. This season, 99 percent do.
“It’s quite shocking,” said Dr. Kent A. Sepkowitz, director of infection control at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. “We’ve never lost an antimicrobial this fast. It blew me away.”
Das Schweinegrippe-Debakel
Wenn derzeit jede Option etwas trostlos erscheint, so wissen wir wenigstens, wie mit solchen Phänomenen nicht umzugehen ist. Die Vorfälle ereigneten sich vor mehr als 30 Jahren in den USA und gingen als großes Schweinegrippen-Debakel in die Medizingeschichte ein.
Damals, am 4. Februar 1976 starb ein junger Soldat in einer Kaserne in New Jersey an Grippe, 19 weitere waren krank und drei davon waren von denselben Viren befallen wie das Todesopfer. In der Laboranalye zeigte sich, dass diese Unterart der Grippeviren starke Ähnlichkeit mit jenen hatte, die normalerweise nur Schweine befällt.
Diese Nachricht schlug in der wissenschaftlichen Kommune der Infektionsexperten ein wie eine Bombe: War die Grippe von den Schweinen auf die Menschen übergesprungen? Handelte es sich hier um eine mutierte Abart jener Viren, die im Nachkriegswinter 1918/19 jene weltweite Katastrophe ausgelöst hatte, in dessen Verlauf mehr Menschen starben als zuvor in vier Kriegsjahren. Die Expertengremien tagten rund um die Uhr, die Zeit drängte und schließlich wurde gehandelt. Präsident Gerald Ford verkündete im Fernsehen, dass „jeder Mann, jede Frau und jedes Kind“ in einer konzertierten Aktion gegen die tödlichen Epidemie geimpft werde. Ansonsten – so die dramatische Hochrechnung – würden noch im selben Jahr 1976 rund eine Million Amerikaner sterben.

President Gerald Ford geht mit Beispiel voran
Obwohl es in der Kaserne in New Jersey bei dem einen Todesfall blieb und weitere fünfhundert infizierte Soldaten mit der Grippe leicht fertig wurden, lief die Produktion des im Hauruck-Verfahren zugelassenen Impfstoffes das ganze Jahr über auf Hochtouren, um im Herbst, wenn das tödliche Virus zweifellos wiederkommen würde, gerüstet zu sein.
Und schließlich startete die generalstabsmäßig vorbereitete Aktion. Gleich zu Beginn starben in Pittsburgh drei Geimpfte innerhalb weniger Stunden. Das wurde als tragischer Zufall angesehen, die Aktion lief weiter. Insgesamt 45 Millionen Impfungen wurden verabreicht, zahlreiche Nebenwirkungen traten auf. Doch das galt als notwendiger Preis, den es für die Abwendung einer Katastrophe eben zu zahlen galt. Bis im Dezember 1976 ein Zwischenbericht der Behörden erschien, der zeigte, dass die Nebenwirkungen ein enormes Ausmaß annahmen. Besonders alarmierend war das Auftreten tausender Fälle von Guillain-Barre-Syndrom (GBS). Bei dieser Störung des Immunsystems leiden die Patienten unter Lähmungen, die tödlich enden können.
Am 16. Dezember wurde die Impfkampagne eingestellt. Die GBS-Opfer bekamen 90 Millionen Dollar Schadenersatz. Insgesamt hatte die Aktion 400 Millionen Dollar gekostet. Was die meisten Medizin-Experten für eine gute Idee gehalten hatten, ging stattdessen als Debakel in die Annalen der Medizin ein.
Harvey Fineberg, Dekan der Harvard School of Public Health gab in seiner abschließenden Analyse der Aktion auch einige Warnungen für die Zukunft mit: „Versprechen wir uns nicht zuviel von unseren Möglichkeiten“, appellierte er, „denken wir stets auch an das Unerwartete und rechnen wir niemals damit, dass die Experten später – wenn die Dinge sich überraschend ändern – auch noch zu dem stehen, was sie vorher gemeinsam empfohlen haben.“
... link (5 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 22. April 2009
Lobbying macht sich bezahlt
malamud, 13:55h
In einer Aussendung der Agentur Welldone wird zu einer Pressekonferenz für kommenden Montag im Presseclub Concordia eingeladen, bei der es um folgende scheinbar harmlose und durchaus erfreuliche Mitteilung geht:
Mit dem Inkrafttreten einer neuen Verordnungsregelung ab 1. Mai 2009 wurde nun ein weiterer Meilenstein in der rA-Therapie gesetzt: Bei Nichtansprechen auf die Behandlung mit 1 Basistherapeutikum kann sofort auf ein Biologikum umgestellt werden. Dies ermöglicht eine bessere Versorgung und eine Steigerung der Lebensqualität der Patienten.
Hier die Vorgeschichte:
Über mehrere Wochen schaltete die Initiative "Der Österreichische Patient" zahlreiche ganzseitige Inserate in den wichtigsten Zeitungen, um eine möglichst frühzeitige Therapie der Rheumatoiden Arthritis einzufordern. Nun deckte "Transparency International" auf, dass es sich dabei in Wahrheit um eine verdeckte Werbekampagne des US-Konzerns Wyeth für das Präparat Enbrel handelt.
In der ersten Phase der Anzeigen-Kampagne wurden wichtige "Player" des österreichischen Gesundheitssystems direkt angesprochen und mit den Folgekosten konfrontiert, die bei Rheumapatienten anfallen. Im Schnitt, heißt es, summieren sich diese Kosten für Krankenstände, Operationen und Krankenhausaufenthalte pro Patient auf jährlich 21.768 Euro. Dies könnte durch den frühzeitigen Einsatz neuer Arzneimittel geändert werden.
Und dann folgt in Balkenlettern die Frage, z.B. an Franz Bittner, den Chef der Wiener Gebietskrankenkasse:
WIE SIEHT IHRE LÖSUNG DAFÜR AUS, HERR BITTNER?
Die Antworten der damit konfrontierten Kammer- und Kassenfunktionäre ist vom Tenor recht einhellig: klar, doch, logisch! früher behandeln ist sinnvoll, wenn man damit Leid und Geld gleichzeitig sparen kann.
Oder im Originalton, wieder von Franz Bittner:
Gerade bei rheumatoider Arthritis ist ein früher Therapie beginn entscheidend, da die schwerwiegendsten Schäden in den ersten beiden Erkrankungsjahren entstehen. Hier gilt es, alte Denkmuster zu entsorgen und ihnen die tatsächliche Kostenwahrheit fair gegenüberzustellen. Natürlich ist der möglichst frühe Einsatz moderner Medikamente zuerst einmal kostenintensiver. Aber was man sich ersparen kann, neben Leid für die Betroffenen, sind die Folgekosten durch Krankenstände, Operationen, Prothesen, Krankenhausaufenthalte etc.
Wer sich über die Urheber dieser doch recht aufwändigen oder teuren Kampagne informieren wollte, wurde auf zwei Patientenorganisationen verwiesen: die Rheumaliga und die Initiative "Der Österreichische Patient".
Andrea Fried, Chefredakteurin der ÖKZ und Mitglied des Beirates von "Transparency International", deckte kürzlich in einem Editorial des aktuellen HTA-Newsletters des Wiener Ludwig Boltzmann Institutes auf, dass es keineswegs Patienteninitiativen waren, die diese Kampagne finanziert haben, sondern der US-Konzern Wyeth, der die Wiener Werbeagentur Welldone dafür mit einem kolportierten Auftrags-Etat von rund 300.000 EUR bedachte.
Auffällig ist die Herkunft der Initiative "Der Österreichische Patient". Dabei, so Fried,
...handelt es sich um eine Kooperation der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM) und dem Verein Altern mit Zukunft - beide enge Partner und Kunden der Werbeagentur Welldone, wo sich auch die Kontaktadresse der Initiative "Der Österreichische Patient" befindet.
Andrea Fried findet es höchst eigenartig, warum Versicherer (wie z.B. Franz Bittner) ausgerechnet pharmagesponserte Inserate brauchen, um auf eine vermeintlich schlechte Versorgung von PatientInnen hinzuweisen. "Sollte es hier wirklich Mängel geben", schließt Fried, wären statt Inseraten wohl eher Handlungen gefragt.
Interessant ist neben dem finanziellen auch der fachliche Hintergrund der Kampagne.
Dem Auftraggeber Wyeth geht es offensichtlich darum, den Umsatz seines Medikamentes Enbrel (Wirkstoff Etanercept) zu erhöhen.
So wie Humira (Adalimumab) oder Remicade (Infliximab) gehört Enbrel zu den TNF-Blockern. Es handelt sich dabei um gentechnisch hergestellte Proteine, die in den Kreislauf der Immunreaktion eingreifen uu damit das - bei Rheuma aus dem Ruder gelaufene - autoaggressive Potenzial zu reduzieren.
Enbrel kostet für die in der Praxis üblichen Drei-Monats-Kur pro Patient fast 5.000 EUR und ist derzeit, so wie die anderen beiden Präparate, bei therapieresistenter mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis zugelassen.
"Für eine frühere oder breitere Anwendung", sagte mir der Stockerauer Rheuma-Experte Burkhart Leeb, "gibt es jedoch derzeit noch viel zu wenig Daten. Ich wäre da sehr vorsichtig."
Zumal die Nebenwirkungen, obzwar selten, so doch sehr ernsthaft sein können.
Im Austria Codex werden diese so zusammengefasst:
Lokale Reaktionen, Infektionen (auch schwerwiegend), unspezifische Symptome, Lupus, Allergien, Blutbild, sehr selten ZNS entmyelinisierende Ereignisse
Seit kurzem wird zudem ein höheres Krebsrisiko diskutiert (Zitat aus: a-t 2006; 37: 59-60):
Auch der Verdacht, dass sie Lymphome und andere Krebserkrankungen auslösen können, ist bislang nicht ausgeräumt. Die Störwirkungen sind biologisch plausibel, da TNF α an der Abwehr von Infektionen und bösartigen Erkrankungen beteiligt ist. Eine Auswertung der in randomisierten klinischen Studien und offenen Verlängerungsphasen bei Patienten mit rheumatoider Arthritis unter Etanercept, Infliximab und Adalimumab dokumentierten Lymphome ergibt, jeweils bezogen auf eine hinsichtlich Alter und Geschlecht vergleichbare "Normalbevölkerung", für Etanercept ein relatives Risiko von 2,31 (95% Konfidenzintervall [CI] 0,85-5,03), für Adalimumab von 5,52 (95% CI 2,6-10,0) und für Infliximab von 6,35 (95% CI 1,7-16,3).
Mit dem Inkrafttreten einer neuen Verordnungsregelung ab 1. Mai 2009 wurde nun ein weiterer Meilenstein in der rA-Therapie gesetzt: Bei Nichtansprechen auf die Behandlung mit 1 Basistherapeutikum kann sofort auf ein Biologikum umgestellt werden. Dies ermöglicht eine bessere Versorgung und eine Steigerung der Lebensqualität der Patienten.
Hier die Vorgeschichte:
Über mehrere Wochen schaltete die Initiative "Der Österreichische Patient" zahlreiche ganzseitige Inserate in den wichtigsten Zeitungen, um eine möglichst frühzeitige Therapie der Rheumatoiden Arthritis einzufordern. Nun deckte "Transparency International" auf, dass es sich dabei in Wahrheit um eine verdeckte Werbekampagne des US-Konzerns Wyeth für das Präparat Enbrel handelt.
In der ersten Phase der Anzeigen-Kampagne wurden wichtige "Player" des österreichischen Gesundheitssystems direkt angesprochen und mit den Folgekosten konfrontiert, die bei Rheumapatienten anfallen. Im Schnitt, heißt es, summieren sich diese Kosten für Krankenstände, Operationen und Krankenhausaufenthalte pro Patient auf jährlich 21.768 Euro. Dies könnte durch den frühzeitigen Einsatz neuer Arzneimittel geändert werden.
Und dann folgt in Balkenlettern die Frage, z.B. an Franz Bittner, den Chef der Wiener Gebietskrankenkasse:
WIE SIEHT IHRE LÖSUNG DAFÜR AUS, HERR BITTNER?
Die Antworten der damit konfrontierten Kammer- und Kassenfunktionäre ist vom Tenor recht einhellig: klar, doch, logisch! früher behandeln ist sinnvoll, wenn man damit Leid und Geld gleichzeitig sparen kann.
Oder im Originalton, wieder von Franz Bittner:
Gerade bei rheumatoider Arthritis ist ein früher Therapie beginn entscheidend, da die schwerwiegendsten Schäden in den ersten beiden Erkrankungsjahren entstehen. Hier gilt es, alte Denkmuster zu entsorgen und ihnen die tatsächliche Kostenwahrheit fair gegenüberzustellen. Natürlich ist der möglichst frühe Einsatz moderner Medikamente zuerst einmal kostenintensiver. Aber was man sich ersparen kann, neben Leid für die Betroffenen, sind die Folgekosten durch Krankenstände, Operationen, Prothesen, Krankenhausaufenthalte etc.
Wer sich über die Urheber dieser doch recht aufwändigen oder teuren Kampagne informieren wollte, wurde auf zwei Patientenorganisationen verwiesen: die Rheumaliga und die Initiative "Der Österreichische Patient".
Andrea Fried, Chefredakteurin der ÖKZ und Mitglied des Beirates von "Transparency International", deckte kürzlich in einem Editorial des aktuellen HTA-Newsletters des Wiener Ludwig Boltzmann Institutes auf, dass es keineswegs Patienteninitiativen waren, die diese Kampagne finanziert haben, sondern der US-Konzern Wyeth, der die Wiener Werbeagentur Welldone dafür mit einem kolportierten Auftrags-Etat von rund 300.000 EUR bedachte.
Auffällig ist die Herkunft der Initiative "Der Österreichische Patient". Dabei, so Fried,
...handelt es sich um eine Kooperation der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM) und dem Verein Altern mit Zukunft - beide enge Partner und Kunden der Werbeagentur Welldone, wo sich auch die Kontaktadresse der Initiative "Der Österreichische Patient" befindet.
Andrea Fried findet es höchst eigenartig, warum Versicherer (wie z.B. Franz Bittner) ausgerechnet pharmagesponserte Inserate brauchen, um auf eine vermeintlich schlechte Versorgung von PatientInnen hinzuweisen. "Sollte es hier wirklich Mängel geben", schließt Fried, wären statt Inseraten wohl eher Handlungen gefragt.
Interessant ist neben dem finanziellen auch der fachliche Hintergrund der Kampagne.
Dem Auftraggeber Wyeth geht es offensichtlich darum, den Umsatz seines Medikamentes Enbrel (Wirkstoff Etanercept) zu erhöhen.
So wie Humira (Adalimumab) oder Remicade (Infliximab) gehört Enbrel zu den TNF-Blockern. Es handelt sich dabei um gentechnisch hergestellte Proteine, die in den Kreislauf der Immunreaktion eingreifen uu damit das - bei Rheuma aus dem Ruder gelaufene - autoaggressive Potenzial zu reduzieren.
Enbrel kostet für die in der Praxis üblichen Drei-Monats-Kur pro Patient fast 5.000 EUR und ist derzeit, so wie die anderen beiden Präparate, bei therapieresistenter mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis zugelassen.
"Für eine frühere oder breitere Anwendung", sagte mir der Stockerauer Rheuma-Experte Burkhart Leeb, "gibt es jedoch derzeit noch viel zu wenig Daten. Ich wäre da sehr vorsichtig."
Zumal die Nebenwirkungen, obzwar selten, so doch sehr ernsthaft sein können.
Im Austria Codex werden diese so zusammengefasst:
Lokale Reaktionen, Infektionen (auch schwerwiegend), unspezifische Symptome, Lupus, Allergien, Blutbild, sehr selten ZNS entmyelinisierende Ereignisse
Seit kurzem wird zudem ein höheres Krebsrisiko diskutiert (Zitat aus: a-t 2006; 37: 59-60):
Auch der Verdacht, dass sie Lymphome und andere Krebserkrankungen auslösen können, ist bislang nicht ausgeräumt. Die Störwirkungen sind biologisch plausibel, da TNF α an der Abwehr von Infektionen und bösartigen Erkrankungen beteiligt ist. Eine Auswertung der in randomisierten klinischen Studien und offenen Verlängerungsphasen bei Patienten mit rheumatoider Arthritis unter Etanercept, Infliximab und Adalimumab dokumentierten Lymphome ergibt, jeweils bezogen auf eine hinsichtlich Alter und Geschlecht vergleichbare "Normalbevölkerung", für Etanercept ein relatives Risiko von 2,31 (95% Konfidenzintervall [CI] 0,85-5,03), für Adalimumab von 5,52 (95% CI 2,6-10,0) und für Infliximab von 6,35 (95% CI 1,7-16,3).
... link (2 Kommentare) ... comment
Dienstag, 21. April 2009
Rezension: "Der Betrüger" von Damon Galgut
malamud, 20:14h
Der südafrikanische Autor Damon Galgut erschafft in diesem Roman Charaktere, die völlig eigenständig sind und keinerlei Klischee entsprechen. Dasselbe gilt für die Handlung: Sie hört sich so eigenartig an, dass man darin kaum Spannung vermutet. Doch das täuscht. Man kann das Buch kaum aus der Hand legen.
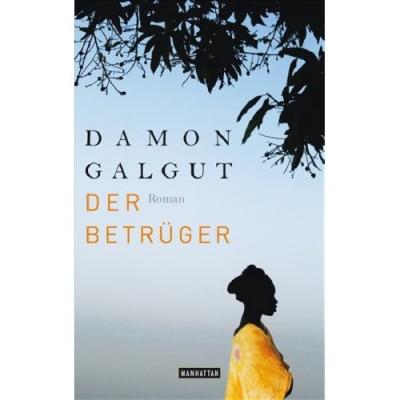
Adam, Mitte vierzig, aus der weißen Mittelschicht Kapstadts hat Job, Haus und Existenz verloren. Da erinnert er sich an seinen Jugendtraum, Gedichte zu schreiben. Sein reich gewordener Bruder bietet ihm ein verwahrlostes Haus in der Karoo Halbwüste als Unterschlupf an. Dort lebt Adam untätig in den Tag hinein, verliert sich immer mehr in depressiven Tagträumen, die ihn lähmen. Er ist zu nichts fähig. Weder kann er das Unkraut entfernen, das seinen Garten überwuchert - noch findet er die ersehnte lyrische Inspiration. Seinem fleißigen Nachbarn Blom weicht er aus. Sogar als dieser Adams Wasserpumpe repariert, verachtet Adam ihn als ungebildetes Landei, mindestens eine Kaste unter ihm - dem Angehörigen der Mittelklasse, der derzeit "kreative Auszeit" nimmt. Bloms Annäherungsversuche sind wiederum höchst unbeholfen. Ab und zu kommt er halb betrunken mit billigem Brandy zu Adam, der ihm angeekelt ausweicht.
Schließlich begegnet Adam zufällig seinem ehemaligen Mitschüler Canning, einem zwiespältigen Menschen, der von seinem Vater ein regelrechtes Paradies geerbt hat: Gondwana. Canning, hasste seinen Vater inbrünstig - und nach und nach stellt sich heraus, dass Canning vor allem eine große Idee antreibt: sich über den Tod hinaus an seinem Vater zu rächen. Sogar die Wahl der schwarzen Ex-Prostitutierten "Baby" als neue Ehefrau sieht Canning als eine Abrechnung an dem weißen Jäger und Patriarchen.
Galguts Figuren sind alles andere als sympathisch. Adam, der in allen seinen Lebenszielen und Gefühlen kalt und egoistisch bleibt. Der rätselhafte Blom, der sich absolut sicher ist, dass Adam ihn eines Tages töten wird. Canning mit seinen schizophrenen Schwankungen von innigster Zuneigung zu sofortigem abgrundtief zynischem Hass. Und schließlich Baby, die in Ihrem Leben vor allem eines gelernt hat: dass Ihre makellose Schönheit besser von ihr selbst, als von anderen benutzt wird, um Ziele zu erreichen. So betrügt sie Canning skrupellos - auch mit Adam, der über der Sehnsucht nach Sex plötzlich wieder zum Dichter wird.
Das Buch entwickelt einen unglaublichen Sog und es führt tief in das "neue Südafrika", mit seinen turbokapitalisitischen Boom-Städten, dem Elend in den rasch herausgestampften Slums mit Namen wie "Nuwe Hoop" - und den allzeit korruptionsbereiten Politikern. Und es zeigt ein faszinierendes Beziehungsgeflecht, das aus einer Vergangenheit wuchert, die von allen Beteiligten verdrängt und gefürchtet wird.
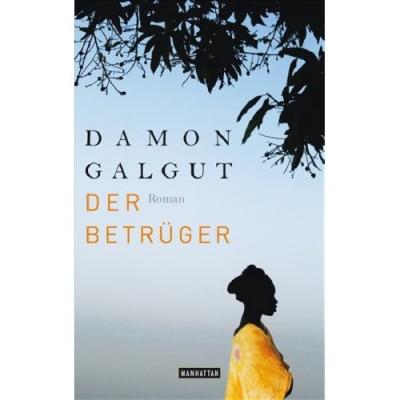
Adam, Mitte vierzig, aus der weißen Mittelschicht Kapstadts hat Job, Haus und Existenz verloren. Da erinnert er sich an seinen Jugendtraum, Gedichte zu schreiben. Sein reich gewordener Bruder bietet ihm ein verwahrlostes Haus in der Karoo Halbwüste als Unterschlupf an. Dort lebt Adam untätig in den Tag hinein, verliert sich immer mehr in depressiven Tagträumen, die ihn lähmen. Er ist zu nichts fähig. Weder kann er das Unkraut entfernen, das seinen Garten überwuchert - noch findet er die ersehnte lyrische Inspiration. Seinem fleißigen Nachbarn Blom weicht er aus. Sogar als dieser Adams Wasserpumpe repariert, verachtet Adam ihn als ungebildetes Landei, mindestens eine Kaste unter ihm - dem Angehörigen der Mittelklasse, der derzeit "kreative Auszeit" nimmt. Bloms Annäherungsversuche sind wiederum höchst unbeholfen. Ab und zu kommt er halb betrunken mit billigem Brandy zu Adam, der ihm angeekelt ausweicht.
Schließlich begegnet Adam zufällig seinem ehemaligen Mitschüler Canning, einem zwiespältigen Menschen, der von seinem Vater ein regelrechtes Paradies geerbt hat: Gondwana. Canning, hasste seinen Vater inbrünstig - und nach und nach stellt sich heraus, dass Canning vor allem eine große Idee antreibt: sich über den Tod hinaus an seinem Vater zu rächen. Sogar die Wahl der schwarzen Ex-Prostitutierten "Baby" als neue Ehefrau sieht Canning als eine Abrechnung an dem weißen Jäger und Patriarchen.
Galguts Figuren sind alles andere als sympathisch. Adam, der in allen seinen Lebenszielen und Gefühlen kalt und egoistisch bleibt. Der rätselhafte Blom, der sich absolut sicher ist, dass Adam ihn eines Tages töten wird. Canning mit seinen schizophrenen Schwankungen von innigster Zuneigung zu sofortigem abgrundtief zynischem Hass. Und schließlich Baby, die in Ihrem Leben vor allem eines gelernt hat: dass Ihre makellose Schönheit besser von ihr selbst, als von anderen benutzt wird, um Ziele zu erreichen. So betrügt sie Canning skrupellos - auch mit Adam, der über der Sehnsucht nach Sex plötzlich wieder zum Dichter wird.
Das Buch entwickelt einen unglaublichen Sog und es führt tief in das "neue Südafrika", mit seinen turbokapitalisitischen Boom-Städten, dem Elend in den rasch herausgestampften Slums mit Namen wie "Nuwe Hoop" - und den allzeit korruptionsbereiten Politikern. Und es zeigt ein faszinierendes Beziehungsgeflecht, das aus einer Vergangenheit wuchert, die von allen Beteiligten verdrängt und gefürchtet wird.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 17. April 2009
Opfer, Täter, Mitläufer: Mobbing in der Schule
malamud, 13:03h
Lehrer und Eltern bekommen davon wenig mit. Doch für zahlreiche Schüler ist Mobbing ein enormes Problem, das ihren Alltag zur Hölle macht. Am Freitag hält der Göttinger Mobbing-Experte Karl Gebauer zu dem brisanten Thema einen Vortrag in St. Pölten.

Alice, 13, schrieb seit der Volksschule immer gute Noten und lernte gerne. Auch nach ihrem Wechsel in ein Gymnasium in St. Pölten war sie Klassenbeste. Bis sich vor zwei Jahren ihr Leben dramatisch änderte: „Alles ging von einem Mädchen aus, das mich nicht mochte“, berichtet sie. „Das Mädchen hat mich ständig eine Streberin und Schleimerin genannt“, erzählt Alice. Die Mitschüler schauten zuerst nur lachend zu, dann machten einige mit und gingen auch auf sie los. „Ich war total verunsichert, habe zu lernen aufgehört und immer schlechtere Noten bekommen.“ Alice hoffte, dass damit die Schikanen aufhören würden. Doch es wurde nur noch schlimmer. „Sie haben mir Sachen kaputt gemacht, mich beleidigt, angespuckt und immer gesagt, ich bin hässlich.“
„Gemobbte Kinder haben einen ungeheuren Ehrenkodex“, erklärt Kathrin Liebing, Schulsozialarbeiterin aus St. Pölten. „Meist erleiden sie einen langen inneren Konflikt, bevor sie endlich jemand erzählen, was sie mitmachen.“
Einmal wurde Alice von einem Lehrer angesprochen. Er fragte, was mit ihr los sei. Sie weinte, vertraute sich ihm an. Daraufhin wandte sich der Lehrer an die Mobber. „Doch das ging total nach hinten los“, erzählt Alice. „Ich war nun als Petze verschrien.“
Auch ihre Mutter war keine Hilfe. Hier bekam sie nur die Botschaft: „Da musst Du durch. Das wird schon aufhören.“ Alice blieb immer häufiger mit Bauchschmerzen von der Schule zu Hause, oder bog vor dem Schultor wieder ab, ging irgendwo hin. „Wo ich war, weiß ich gar nicht mehr“, sagt Alice. „Es kommt bei den Schülern in solchen Fällen oft zu einem Blackout“, erklärt der Göttinger Lernforscher und Mobbing-Experte Karl Gebauer. „Sie wissen nicht, wo sie hin sollen, haben zu niemand mehr Vertrauen.“
Mittlerweile hat Alice die Schule gewechselt und ist – nach schwerer Depression – in psychiatrischer Behandlung. „Was ich durchgemacht habe“, sagt sie, „wünsche ich niemandem.“
Mobbing ist ein aggressiver Akt und bedeutet, dass ein Schüler oder eine Schülerin über einen längeren Zeitraum von Mitschülern belästigt, schikaniert oder ausgegrenzt wird. Mobbing läuft in der Regel verdeckt ab. „Mobber wollen treffen, aber selber nichts abbekommen“, erklärt Karl Gebauer. „Die Opfer fühlen sich hilflos und können sich nicht allein aus ihrer Isolation befreien.“
Bei Buben ist Mobbing rasch auch mit körperlicher Gewalt und Erpressung verbunden. „Kauf mir eine Jause, sonst erlebst Du was…“. Solche Drohungen, oft nur im Vorbeigehen geäußert, bekommen Lehrer nur in den seltensten Fällen mit. Doch Kinder die einmal in der Defensive sind, kommen nur noch schwer alleine raus.
Für Erzieher, Sozialpädagogen und Lehrer ist der Umgang damit enorm schwierig. In der Ausbildung wird darauf kaum eingegangen. Patent-Rezepte gibt es ohnedies nicht. „Überall wo Mobbing passiert, gehen Beziehungen in Brüche“, sagt Gebauer, „wenn Kinder in eine Mobbing-Situation geraten, sind sie völlig hilflos, es braucht dafür Helfer mit Durchblick und Mut.“
Professionelle Ansprechpartner für Kinder, aber auch für Lehrer oder betroffene Eltern sind die auf Schulprobleme spezialisierten Sozialarbeiter, etwa jene von x-point, einer Organisation die an 25 Schulen Niederösterreichs aktiv ist. „Die Täter haben oft gar nicht das Gefühl, dass sie Gewalt ausüben“, erklärt Sozialarbeiterin Liebing. „Sie halten das für Spaß und finden dann bereitwillige Nachahmer und Mittäter.“ Wichtig sei es, sagt Liebing, dass sowohl die Eltern als auch die Lehrer sensibler für diese Problematik werden. „Denn wenn sich das verfestigt bei den Kindern und es zu keiner Lösung kommt, kann das verheerend sein und sogar im Selbstmord enden.“

Dr. Karl Gebauer, ist eh. Rektor der Leineberg-Grundschule in Göttingen. Der Autor zahlreicher Bücher gründete gemeinsam mit dem Neurobiologen Prof. Gerald Hüther die Aktion WIN-Future, ein wissenschaftliches Netzwerk für Entwicklungs- und Bildungsforschung. Sein Vortrag richtet sich vor allem an Eltern und Lehrer.
Am Samstag, dem 25. April ist Dr. Gebauer auch Teilnehmer beim „Dialogforum“ der Lernwerkstatt im Wasserschloss Pottenbrunn im Rahmen des lws:fest.tag09


Alice, 13, schrieb seit der Volksschule immer gute Noten und lernte gerne. Auch nach ihrem Wechsel in ein Gymnasium in St. Pölten war sie Klassenbeste. Bis sich vor zwei Jahren ihr Leben dramatisch änderte: „Alles ging von einem Mädchen aus, das mich nicht mochte“, berichtet sie. „Das Mädchen hat mich ständig eine Streberin und Schleimerin genannt“, erzählt Alice. Die Mitschüler schauten zuerst nur lachend zu, dann machten einige mit und gingen auch auf sie los. „Ich war total verunsichert, habe zu lernen aufgehört und immer schlechtere Noten bekommen.“ Alice hoffte, dass damit die Schikanen aufhören würden. Doch es wurde nur noch schlimmer. „Sie haben mir Sachen kaputt gemacht, mich beleidigt, angespuckt und immer gesagt, ich bin hässlich.“
„Gemobbte Kinder haben einen ungeheuren Ehrenkodex“, erklärt Kathrin Liebing, Schulsozialarbeiterin aus St. Pölten. „Meist erleiden sie einen langen inneren Konflikt, bevor sie endlich jemand erzählen, was sie mitmachen.“
Einmal wurde Alice von einem Lehrer angesprochen. Er fragte, was mit ihr los sei. Sie weinte, vertraute sich ihm an. Daraufhin wandte sich der Lehrer an die Mobber. „Doch das ging total nach hinten los“, erzählt Alice. „Ich war nun als Petze verschrien.“
Auch ihre Mutter war keine Hilfe. Hier bekam sie nur die Botschaft: „Da musst Du durch. Das wird schon aufhören.“ Alice blieb immer häufiger mit Bauchschmerzen von der Schule zu Hause, oder bog vor dem Schultor wieder ab, ging irgendwo hin. „Wo ich war, weiß ich gar nicht mehr“, sagt Alice. „Es kommt bei den Schülern in solchen Fällen oft zu einem Blackout“, erklärt der Göttinger Lernforscher und Mobbing-Experte Karl Gebauer. „Sie wissen nicht, wo sie hin sollen, haben zu niemand mehr Vertrauen.“
Mittlerweile hat Alice die Schule gewechselt und ist – nach schwerer Depression – in psychiatrischer Behandlung. „Was ich durchgemacht habe“, sagt sie, „wünsche ich niemandem.“
Mobbing ist ein aggressiver Akt und bedeutet, dass ein Schüler oder eine Schülerin über einen längeren Zeitraum von Mitschülern belästigt, schikaniert oder ausgegrenzt wird. Mobbing läuft in der Regel verdeckt ab. „Mobber wollen treffen, aber selber nichts abbekommen“, erklärt Karl Gebauer. „Die Opfer fühlen sich hilflos und können sich nicht allein aus ihrer Isolation befreien.“
Bei Buben ist Mobbing rasch auch mit körperlicher Gewalt und Erpressung verbunden. „Kauf mir eine Jause, sonst erlebst Du was…“. Solche Drohungen, oft nur im Vorbeigehen geäußert, bekommen Lehrer nur in den seltensten Fällen mit. Doch Kinder die einmal in der Defensive sind, kommen nur noch schwer alleine raus.
Für Erzieher, Sozialpädagogen und Lehrer ist der Umgang damit enorm schwierig. In der Ausbildung wird darauf kaum eingegangen. Patent-Rezepte gibt es ohnedies nicht. „Überall wo Mobbing passiert, gehen Beziehungen in Brüche“, sagt Gebauer, „wenn Kinder in eine Mobbing-Situation geraten, sind sie völlig hilflos, es braucht dafür Helfer mit Durchblick und Mut.“
Professionelle Ansprechpartner für Kinder, aber auch für Lehrer oder betroffene Eltern sind die auf Schulprobleme spezialisierten Sozialarbeiter, etwa jene von x-point, einer Organisation die an 25 Schulen Niederösterreichs aktiv ist. „Die Täter haben oft gar nicht das Gefühl, dass sie Gewalt ausüben“, erklärt Sozialarbeiterin Liebing. „Sie halten das für Spaß und finden dann bereitwillige Nachahmer und Mittäter.“ Wichtig sei es, sagt Liebing, dass sowohl die Eltern als auch die Lehrer sensibler für diese Problematik werden. „Denn wenn sich das verfestigt bei den Kindern und es zu keiner Lösung kommt, kann das verheerend sein und sogar im Selbstmord enden.“

Dr. Karl Gebauer, ist eh. Rektor der Leineberg-Grundschule in Göttingen. Der Autor zahlreicher Bücher gründete gemeinsam mit dem Neurobiologen Prof. Gerald Hüther die Aktion WIN-Future, ein wissenschaftliches Netzwerk für Entwicklungs- und Bildungsforschung. Sein Vortrag richtet sich vor allem an Eltern und Lehrer.
Am Samstag, dem 25. April ist Dr. Gebauer auch Teilnehmer beim „Dialogforum“ der Lernwerkstatt im Wasserschloss Pottenbrunn im Rahmen des lws:fest.tag09

... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 10. April 2009
„Das ganze Diabetes-Konzept stimmt nicht“
malamud, 17:54h
Der Grazer Diabetologe Thomas Pieber fordert neue Richtlinien zur Behandlung der Volkskrankheit.

Ehgartner: In den letzten Monaten sind gleich drei große Studien erschienen, die den Wert der Blutzuckersenkung kräftig erschüttern. Welche Bedeutung haben diese Resultate nun im klinischen Alltag bei der Behandlung von Diabetikern?
Pieber: : Es ist nach wie vor notwendig, Diabetiker zu behandeln. Der zentrale Streitpunkt ist die Einstellung des Blutzuckerwertes. Die große Mehrheit der Diabetologen meint, dass der Mittelwert des Blutzuckers, das HbA1c, das alles Entscheidende sei und mit allen Mitteln gesenkt werden muss, je niedriger desto besser.
Ehgartner: War denn die wissenschaftliche Basis dafür so eindeutig?
Pieber: : Eben überhaupt nicht. Die wissenschaftlichen Grundlagen für dieses Konzept fehlen. Diabetiker mit niedrigerem Blutzucker haben zwar eine bessere Prognose, die Frage ist allerdings, warum diese Patienten so gut einzustellen sind. Das ist wissenschaftlich nicht unwesentlich. Denn vielleicht haben sie einfach eine leichtere Form des Diabetes. Dann wäre es nur logisch, dass diese Personen auch weniger Komplikationen haben. Und bei den Patienten mit schwerer Verlaufsform würde es auch nichts helfen, wenn ich den Blutzuckerwert mit vielen Medikamenten mit Gewalt senke. Das Weltbild, das trotzdem den Blutzuckerwert alleine in den Mittelpunkt rückt, war halt auch im Interesse der Industrie.
Ehgartner: Mit Hilfe von Medikamenten eine Volkskrankheit zu behandeln, ist kein schlechtes Geschäft.
Pieber: : Ja, die pharmazeutische Industrie hat uns aus ihren Forschungen immer diese Rückmeldung gegeben Der Blutzucker ist entscheidend. Wenn ich mir die Studienergebnisse des vergangenen Jahres ansehe, so kann man nun sagen: Das stimmt eindeutig nicht, und das scheint jetzt aufgrund der vorliegenden Studienergebnisse endgültig zu sein.
Ehgartner: Es geht also eher um die Frage, wie der Zucker ins Blut kommt.
Pieber: : Medikamente ersetzen keinen gesunden Lebensstil. Das ist eben der große Unterschied. Im Vergleich zu dem, was wir für die Medikamente ausgeben, investieren wir in Wahrheit nur sehr wenig in das Ziel, durch gesunde Ernährung und Bewegung gar nicht erst zuckerkrank zu werden. Das ist leider mühsam und anstrengend und kann nicht so einfach verordnet werden. Da hilft kein Schimpfen und Drohen, das funktioniert nicht. Obwohl wir das schon seit 20 Jahren wissen, gibt es kaum Forschung nach alternativen Strategien. Körpergewicht zu reduzieren ist schwierig und die Leute wirksam zur Bewegung zu animieren auch. Die Bemühungen waren nicht ausreichend, auch weil sich alle darauf verlassen haben, dass die Medikamente schon ihren Zweck erfüllen.
Ehgartner: Wäre es als Diabetes-Experte nicht möglich gewesen, viel früher drauf zu kommen, dass der Hase falsch läuft?
Pieber: : Es gab schon in den 70er und 90er Jahren große Untersuchungen, die gezeigt haben, dass das ganze Konzept nicht stimmt. Wenn man sie kritisch gelesen hat, wusste man längst, dass die Tabletten das Problem nicht lösen. Nun haben wir in der ACCORD-Studie gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben sogar steigt, wenn ein Patient mit den verfügbaren Medikamenten scharf eingestellt wird. Und zwar steigt das Risiko gleich um 22 Prozent! Jetzt haben wir ein Ergebnis, das so eindeutig ist, dass allen klar sein muss: so geht es nicht!
Ehgartner: Diese Entwicklung erinnert sehr an den Irrweg der Hormonersatz-Therapie. Seit nicht mehr an fast alle Frauen ab der Menopause Hormonpillen verschrieben werden, gehen erstmals sogar die Brustkrebs-Zahlen stark zurück. Steht nun bei Diabetes ein ähnlich radikaler Kurswechsel bevor?
Pieber: : Ja eindeutig. Die Blutzucker-zentrische Sichtweise des Diabetes ist eine Sackgasse. Wenn nur eine einzige Studie dagegen sprechen würde, so könnte man noch argumentieren, dass dies ein Ausreißer ist. Aber es gibt noch zwei weitere Studien, die ebenfalls keinen Nutzen der medikamentösen Zuckersenkung zeigen. Warum muss ich die Leute also mit allen möglichen Medikamenten so streng einstellen, wenn es ihnen eigentlich nichts bringt. Stattdessen beginnen jetzt die Diabetes-Experten, an den Resultaten herumzudoktern und behaupten – genau wie vor ein paar Jahren die Hormonpäpste – dass die Pillen schon ihren guten Zweck haben und dass nur die Studien total schlecht wären.
Ehgartner: Schlechte Ergebnisse zeigten sich speziell, wenn mehrere Diabetes-Medikamente kombiniert wurden. Waren diese Kombinationen eigentlich erprobt?
Pieber: : Nein. Man ist immer davon ausgegangen, dass die positiven Aspekte der Tabletten sich addieren. Es hat niemand darüber nachgedacht, dass es auch umgekehrt sein könnte. Neben Unterzuckerung und Gewichtszunahme. sind die negativen Effekte im Detail noch gar nicht bekannt.
Ehgartner: Welche Verantwortung trifft hier die Ärzte?
Pieber: : Das ist das Dilemma in der Diabetologie. Die Ärzte haben als Advokaten ihrer Patienten versagt. Sie hätten warnen und hinterfragen müssen – und nicht alles willfährig übernehmen, was ihnen von der Industrie vorgelegt wird. Es ist schon unsere Verantwortung als Ärzte, dass wir nicht Medikamente- verschreiben, die unsere Patienten schädigen oder sogar umbringen könnten Als Diabetesexperten und Universitätsprofessoren haben wir entsprechende Untersuchungen nicht vehement genug eingefordert. Die Zulassungsbehörden hören bei dieser Frage natürlich sehr stark auf die Meinung der Mediziner. Und wenn von dort keine Warnung oder Skepsis kommt, so wird das auch nicht in den Zulassungsanforderungen enthalten sein.
Ehgartner: Wie sieht es denn nun aus mit der Kehrtwende? Wann werden denn die Diabetes-Leitlinien geändert?
Pieber: : Wäre bei den Studien raus gekommen, dass ein ganz niedriger Blutzuckerwert tatsächlich nützlich ist, wäre es innerhalb von Wochen zu einer Verschärfung in diese Richtung gekommen. Umgekehrt ist eine beinahe gespenstische Ruhe eingekehrt. Fast ein Jahr nach Erscheinen von ACCORD gibt es meines Wissens noch keine einzige Leitlinie, die auf das neue Wissen reagierte. Niemand rückt bis jetzt von den extrem niedrig angesetzten Zielwerten ab. Auch in Österreich nicht. Und niemand informiert die praktischen Ärzte.
Ehgartner: Soll man denn künftig vermitteln, dass hohe Zuckerwerte okay sind?
Pieber: : Nein, hohe Zuckerwerte sind nicht okay, wenn die Diabetiker Symptome aufweisen. Aber wenn ich einen Patienten betreue, der seit zehn Jahren an Diabetes leidet, aber relativ beschwerdefrei ist, und dessen Blutzuckerdauerwert bei 8,0 steht, so muss in den Leitlinien stehen, dass es keine wissenschaftliche Basis dafür gibt, dass die medikamentöse Absenkung dieses Zuckerwertes dem Patienten nützt. Und das betrifft Insulin genauso wie Insulinanaloga oder die oralen Antidiabetika.
Wir sollten endlich darüber diskutieren, dass wir jene Risikofaktoren ernst nehmen, mit denen wir nachweislich die Prognose günstig beeinflussen können Zum Beispiel sollten wir bei allen unseren Diabetikern den Blutdruck besser einstellen, da hängen tausende Menschenleben dran.
Thomas Pieber, 47 ist Vorstand der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Nuklearmedizin der Medizinischen Universität Graz. Er war bis 2006 im Vorstand der Europäischen Diabetesgesellschaft (EASD) und ist Präsident der EASD-Jahrestagung 2009.
Das Gespräch führte Bert Ehgartner (eine gekürzte Version dieses Gesprächs ist im Nachrichtenmagazin Profil vom 10. 4. 2009 im Rahmen der Coverstory „Nutzlose Medizin“ erschienen).

Ehgartner: In den letzten Monaten sind gleich drei große Studien erschienen, die den Wert der Blutzuckersenkung kräftig erschüttern. Welche Bedeutung haben diese Resultate nun im klinischen Alltag bei der Behandlung von Diabetikern?
Pieber: : Es ist nach wie vor notwendig, Diabetiker zu behandeln. Der zentrale Streitpunkt ist die Einstellung des Blutzuckerwertes. Die große Mehrheit der Diabetologen meint, dass der Mittelwert des Blutzuckers, das HbA1c, das alles Entscheidende sei und mit allen Mitteln gesenkt werden muss, je niedriger desto besser.
Ehgartner: War denn die wissenschaftliche Basis dafür so eindeutig?
Pieber: : Eben überhaupt nicht. Die wissenschaftlichen Grundlagen für dieses Konzept fehlen. Diabetiker mit niedrigerem Blutzucker haben zwar eine bessere Prognose, die Frage ist allerdings, warum diese Patienten so gut einzustellen sind. Das ist wissenschaftlich nicht unwesentlich. Denn vielleicht haben sie einfach eine leichtere Form des Diabetes. Dann wäre es nur logisch, dass diese Personen auch weniger Komplikationen haben. Und bei den Patienten mit schwerer Verlaufsform würde es auch nichts helfen, wenn ich den Blutzuckerwert mit vielen Medikamenten mit Gewalt senke. Das Weltbild, das trotzdem den Blutzuckerwert alleine in den Mittelpunkt rückt, war halt auch im Interesse der Industrie.
Ehgartner: Mit Hilfe von Medikamenten eine Volkskrankheit zu behandeln, ist kein schlechtes Geschäft.
Pieber: : Ja, die pharmazeutische Industrie hat uns aus ihren Forschungen immer diese Rückmeldung gegeben Der Blutzucker ist entscheidend. Wenn ich mir die Studienergebnisse des vergangenen Jahres ansehe, so kann man nun sagen: Das stimmt eindeutig nicht, und das scheint jetzt aufgrund der vorliegenden Studienergebnisse endgültig zu sein.
Ehgartner: Es geht also eher um die Frage, wie der Zucker ins Blut kommt.
Pieber: : Medikamente ersetzen keinen gesunden Lebensstil. Das ist eben der große Unterschied. Im Vergleich zu dem, was wir für die Medikamente ausgeben, investieren wir in Wahrheit nur sehr wenig in das Ziel, durch gesunde Ernährung und Bewegung gar nicht erst zuckerkrank zu werden. Das ist leider mühsam und anstrengend und kann nicht so einfach verordnet werden. Da hilft kein Schimpfen und Drohen, das funktioniert nicht. Obwohl wir das schon seit 20 Jahren wissen, gibt es kaum Forschung nach alternativen Strategien. Körpergewicht zu reduzieren ist schwierig und die Leute wirksam zur Bewegung zu animieren auch. Die Bemühungen waren nicht ausreichend, auch weil sich alle darauf verlassen haben, dass die Medikamente schon ihren Zweck erfüllen.
Ehgartner: Wäre es als Diabetes-Experte nicht möglich gewesen, viel früher drauf zu kommen, dass der Hase falsch läuft?
Pieber: : Es gab schon in den 70er und 90er Jahren große Untersuchungen, die gezeigt haben, dass das ganze Konzept nicht stimmt. Wenn man sie kritisch gelesen hat, wusste man längst, dass die Tabletten das Problem nicht lösen. Nun haben wir in der ACCORD-Studie gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben sogar steigt, wenn ein Patient mit den verfügbaren Medikamenten scharf eingestellt wird. Und zwar steigt das Risiko gleich um 22 Prozent! Jetzt haben wir ein Ergebnis, das so eindeutig ist, dass allen klar sein muss: so geht es nicht!
Ehgartner: Diese Entwicklung erinnert sehr an den Irrweg der Hormonersatz-Therapie. Seit nicht mehr an fast alle Frauen ab der Menopause Hormonpillen verschrieben werden, gehen erstmals sogar die Brustkrebs-Zahlen stark zurück. Steht nun bei Diabetes ein ähnlich radikaler Kurswechsel bevor?
Pieber: : Ja eindeutig. Die Blutzucker-zentrische Sichtweise des Diabetes ist eine Sackgasse. Wenn nur eine einzige Studie dagegen sprechen würde, so könnte man noch argumentieren, dass dies ein Ausreißer ist. Aber es gibt noch zwei weitere Studien, die ebenfalls keinen Nutzen der medikamentösen Zuckersenkung zeigen. Warum muss ich die Leute also mit allen möglichen Medikamenten so streng einstellen, wenn es ihnen eigentlich nichts bringt. Stattdessen beginnen jetzt die Diabetes-Experten, an den Resultaten herumzudoktern und behaupten – genau wie vor ein paar Jahren die Hormonpäpste – dass die Pillen schon ihren guten Zweck haben und dass nur die Studien total schlecht wären.
Ehgartner: Schlechte Ergebnisse zeigten sich speziell, wenn mehrere Diabetes-Medikamente kombiniert wurden. Waren diese Kombinationen eigentlich erprobt?
Pieber: : Nein. Man ist immer davon ausgegangen, dass die positiven Aspekte der Tabletten sich addieren. Es hat niemand darüber nachgedacht, dass es auch umgekehrt sein könnte. Neben Unterzuckerung und Gewichtszunahme. sind die negativen Effekte im Detail noch gar nicht bekannt.
Ehgartner: Welche Verantwortung trifft hier die Ärzte?
Pieber: : Das ist das Dilemma in der Diabetologie. Die Ärzte haben als Advokaten ihrer Patienten versagt. Sie hätten warnen und hinterfragen müssen – und nicht alles willfährig übernehmen, was ihnen von der Industrie vorgelegt wird. Es ist schon unsere Verantwortung als Ärzte, dass wir nicht Medikamente- verschreiben, die unsere Patienten schädigen oder sogar umbringen könnten Als Diabetesexperten und Universitätsprofessoren haben wir entsprechende Untersuchungen nicht vehement genug eingefordert. Die Zulassungsbehörden hören bei dieser Frage natürlich sehr stark auf die Meinung der Mediziner. Und wenn von dort keine Warnung oder Skepsis kommt, so wird das auch nicht in den Zulassungsanforderungen enthalten sein.
Ehgartner: Wie sieht es denn nun aus mit der Kehrtwende? Wann werden denn die Diabetes-Leitlinien geändert?
Pieber: : Wäre bei den Studien raus gekommen, dass ein ganz niedriger Blutzuckerwert tatsächlich nützlich ist, wäre es innerhalb von Wochen zu einer Verschärfung in diese Richtung gekommen. Umgekehrt ist eine beinahe gespenstische Ruhe eingekehrt. Fast ein Jahr nach Erscheinen von ACCORD gibt es meines Wissens noch keine einzige Leitlinie, die auf das neue Wissen reagierte. Niemand rückt bis jetzt von den extrem niedrig angesetzten Zielwerten ab. Auch in Österreich nicht. Und niemand informiert die praktischen Ärzte.
Ehgartner: Soll man denn künftig vermitteln, dass hohe Zuckerwerte okay sind?
Pieber: : Nein, hohe Zuckerwerte sind nicht okay, wenn die Diabetiker Symptome aufweisen. Aber wenn ich einen Patienten betreue, der seit zehn Jahren an Diabetes leidet, aber relativ beschwerdefrei ist, und dessen Blutzuckerdauerwert bei 8,0 steht, so muss in den Leitlinien stehen, dass es keine wissenschaftliche Basis dafür gibt, dass die medikamentöse Absenkung dieses Zuckerwertes dem Patienten nützt. Und das betrifft Insulin genauso wie Insulinanaloga oder die oralen Antidiabetika.
Wir sollten endlich darüber diskutieren, dass wir jene Risikofaktoren ernst nehmen, mit denen wir nachweislich die Prognose günstig beeinflussen können Zum Beispiel sollten wir bei allen unseren Diabetikern den Blutdruck besser einstellen, da hängen tausende Menschenleben dran.
Thomas Pieber, 47 ist Vorstand der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Nuklearmedizin der Medizinischen Universität Graz. Er war bis 2006 im Vorstand der Europäischen Diabetesgesellschaft (EASD) und ist Präsident der EASD-Jahrestagung 2009.
Das Gespräch führte Bert Ehgartner (eine gekürzte Version dieses Gesprächs ist im Nachrichtenmagazin Profil vom 10. 4. 2009 im Rahmen der Coverstory „Nutzlose Medizin“ erschienen).
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 27. März 2009
Vortrag + Diskussion
malamud, 12:39h
Hier zwei Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen, an denen ich teilnehme. Heute Abend halte ich auf Einladung der "Gesunden Gemeinde Eichgraben" einen Vortrag zu meinem aktuellen Buch "Lob der Krankheit". Die zweite Veranstaltung steht am 1. April um 19,30 Uhr im Radiokulturhaus in der Wiener Argentinierstraße unter dem Motto "Impfung: Schutz oder Schaden?"
Hier die Pressetexte zu den Veranstaltungen:
Warum es gesund ist, ab und zu krank zu sein.
Vortrag von Bert Ehgartner im Fuhrwerkerhaus Eichgraben, 27. 3. 2009, Beginn: 19 Uhr
Das Berufsleben ist stressig, Krankenstand wird ungern toleriert. So machen sich viele - gedopt mit Aspirin & Co. auf den Weg ins Büro, obwohl sie eigentlich im Bett bleiben sollten.
Damit jedoch gehen wir gefährliche Risiken ein. Denn jede Krankheit ist ein Warnsignal. Ein Signal, dass das Stress-System zu lange schon die Reparaturmechanismen des Organismus blockiert.
Den biologischen Sinn von Krankheit stellte der Bestseller Autor Bert Ehgartner in den Mittelpunkt seines aktuellen Buches "Lob der Krankheit", das kürzlich im Verlag Gustav Lübbe erschienen ist.
Und er zeigt darin eindrücklich, welche faszinierendes Rolle Viren und Bakterien - aber auch Schmutz für unsere dauerhafte Gesundheit spielen.
Krankheiten erfüllen einen biologischen Zweck, indem sie die Reifung des Immunsystems - unseres lebenslangen Schutzengels, ermöglichen. Heute jedoch werden vile Krankheiten, speziell bei den Kindern, schon im Ansatz mit Antibiotika, Fiebersenkern und den zahllosen Impfungen "behandelt".
Eine immer strikter werdende Hygiene trägt das ihre dazu bei, warum wir uns heute inmitten einer Epidemie von Allergien und Autoimmunkrankheiten befinden, die eine gemeinsame Wurzel haben: ein aus der Bahn geworfenes Immunsystem.
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.
-----------------
Diskussion im Radiokulturhaus:
Ankündigung im Standard vom 24. März:
Schutz oder Schaden?
Die Wirkung von Impfungen auf den menschlichen Körper
*
Ob Grippe-, HPV- oder Erstimpfung bei Säuglingen und Kleinkindern: Seit der Einführung der ersten Impfung vor mehr als 200 Jahren gegen Pocken sorgt dieses Thema für Kontroversen. Die einen betrachten Impfungen als Mittel, um Krankheiten vorzubeugen oder auszurotten. Die anderen wiederum sehen es als gefährlichen Eingriff in das menschliche Immunsystem und warnen ausdrücklich davor. Dazu kommen weitere kritische Stimmen, die der Pharmaindustrie vorwerfen, die Bevölkerung zu manipulieren und mit dem Thema "Impfungen" Geschäftemacherei zu betreiben.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "hot doc." wird offen über ein Thema diskutiert, das polarisiert und die Meinung der Öffentlichkeit spaltet. Sind die Ängste von Impfgegnern berechtigt? Oder wird hier Panikmache betrieben und damit die Gesundheit von Kindern riskiert?
Referenten:
Pro: Mag. DDRr. Wolfgang Maurer, Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Wien
Contra: Dr. Johann Moravansky, anthroposophischer Kinderarzt
Machen Sie sich selbst ein Bild und diskutieren sie mit!
Zeit: 1. April, 19.30 Uhr
Ort: ORF-Radiokulturhaus, 1040 Wien, Argentinierstraße 30A
Anmeldung: E-Mail: pressestelle@aekwien.at, Tel.: 01/51501 - 1223 DW.
-----------------
Am Podium sitzen neben Dr. Maurer und Dr. Moravansky noch:
Dr. Rudolf Schmitzberger
Kinderarzt und Impfreferent der Ärztekammer für Wien
Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt PhD.MSc.
Professorin für Vakzinologie (Impfwesen) und Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der
Medizinischen Universität Wien
Bert Ehgartner
Wissenschaftspublizist
Moderiert wird die Veranstaltung von Mag. Martin Haidinger, Ö1 Wissenschaftsredaktion
Hier die Pressetexte zu den Veranstaltungen:
Warum es gesund ist, ab und zu krank zu sein.
Vortrag von Bert Ehgartner im Fuhrwerkerhaus Eichgraben, 27. 3. 2009, Beginn: 19 Uhr
Das Berufsleben ist stressig, Krankenstand wird ungern toleriert. So machen sich viele - gedopt mit Aspirin & Co. auf den Weg ins Büro, obwohl sie eigentlich im Bett bleiben sollten.
Damit jedoch gehen wir gefährliche Risiken ein. Denn jede Krankheit ist ein Warnsignal. Ein Signal, dass das Stress-System zu lange schon die Reparaturmechanismen des Organismus blockiert.
Den biologischen Sinn von Krankheit stellte der Bestseller Autor Bert Ehgartner in den Mittelpunkt seines aktuellen Buches "Lob der Krankheit", das kürzlich im Verlag Gustav Lübbe erschienen ist.
Und er zeigt darin eindrücklich, welche faszinierendes Rolle Viren und Bakterien - aber auch Schmutz für unsere dauerhafte Gesundheit spielen.
Krankheiten erfüllen einen biologischen Zweck, indem sie die Reifung des Immunsystems - unseres lebenslangen Schutzengels, ermöglichen. Heute jedoch werden vile Krankheiten, speziell bei den Kindern, schon im Ansatz mit Antibiotika, Fiebersenkern und den zahllosen Impfungen "behandelt".
Eine immer strikter werdende Hygiene trägt das ihre dazu bei, warum wir uns heute inmitten einer Epidemie von Allergien und Autoimmunkrankheiten befinden, die eine gemeinsame Wurzel haben: ein aus der Bahn geworfenes Immunsystem.
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.
-----------------
Diskussion im Radiokulturhaus:
Ankündigung im Standard vom 24. März:
Schutz oder Schaden?
Die Wirkung von Impfungen auf den menschlichen Körper
*
Ob Grippe-, HPV- oder Erstimpfung bei Säuglingen und Kleinkindern: Seit der Einführung der ersten Impfung vor mehr als 200 Jahren gegen Pocken sorgt dieses Thema für Kontroversen. Die einen betrachten Impfungen als Mittel, um Krankheiten vorzubeugen oder auszurotten. Die anderen wiederum sehen es als gefährlichen Eingriff in das menschliche Immunsystem und warnen ausdrücklich davor. Dazu kommen weitere kritische Stimmen, die der Pharmaindustrie vorwerfen, die Bevölkerung zu manipulieren und mit dem Thema "Impfungen" Geschäftemacherei zu betreiben.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "hot doc." wird offen über ein Thema diskutiert, das polarisiert und die Meinung der Öffentlichkeit spaltet. Sind die Ängste von Impfgegnern berechtigt? Oder wird hier Panikmache betrieben und damit die Gesundheit von Kindern riskiert?
Referenten:
Pro: Mag. DDRr. Wolfgang Maurer, Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Wien
Contra: Dr. Johann Moravansky, anthroposophischer Kinderarzt
Machen Sie sich selbst ein Bild und diskutieren sie mit!
Zeit: 1. April, 19.30 Uhr
Ort: ORF-Radiokulturhaus, 1040 Wien, Argentinierstraße 30A
Anmeldung: E-Mail: pressestelle@aekwien.at, Tel.: 01/51501 - 1223 DW.
-----------------
Am Podium sitzen neben Dr. Maurer und Dr. Moravansky noch:
Dr. Rudolf Schmitzberger
Kinderarzt und Impfreferent der Ärztekammer für Wien
Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt PhD.MSc.
Professorin für Vakzinologie (Impfwesen) und Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der
Medizinischen Universität Wien
Bert Ehgartner
Wissenschaftspublizist
Moderiert wird die Veranstaltung von Mag. Martin Haidinger, Ö1 Wissenschaftsredaktion
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories